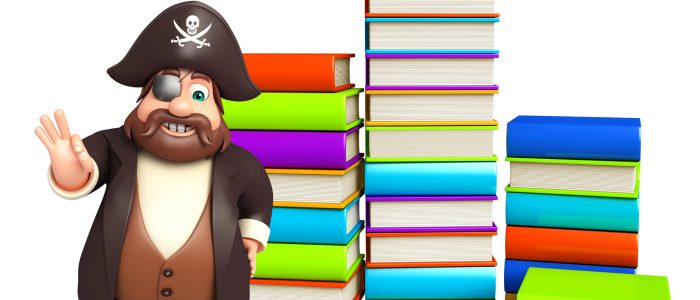Schriftsteller sollten nicht nur dann schreiben, wenn jemand bezahlt. Kaspar Dornfelds Gastbeitrag: Schreibegeld oder Der feindliche Leser.
Schreibegeld?
»Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich irgend etwas ändert.« (Albert Einstein)
»Müssen Sie halt was anständiges bieten, dann bleiben wir auch« (zorniger Zuschauer beim Verlassen des Saales, Landestheater Tübingen, 1996)
Kaspar Dornfeld über Schreibegeld
Als mich die Bitte erreichte, einen Gastbeitrag für diesen Blog zu schreiben, hatte ich gerade die etwas abstoßende Lust, einen Text voller Mutmaßungen darüber zu verfassen, dass Fahrradhändler scheinbar immer versuchen, einen übers Ohr zu hauen. Ein Text voll Empörung, durchmischt mit ein paar Pointen und einer Spur Hausfrauenzynismus. Ganz abgesehen davon, dass die drei Fahrradhändler in meinem näheren Radius alle eine Vollmeise haben. So habe ich für die grundsätzliche Geldgier dieser ganzen Berufsklasse allerdings keine Belege. Und so ein Text wäre wahrscheinlich auch unvermeidbar ziemlich spießbürgerlich. Seien wir meinem Gastgeber also dankbar dafür, dass er mich davon abgebracht hat.
Schreibegeld oder Der feindliche Leser – ein Gastbeitrag von Kaspar Dornfeld.
Schreibegeld oder Der feindliche Leser
Der Grund für diesen Text hier ist einfach: Ich wurde darum gebeten, nachdem ich so vorwitzig war, einen anderen Gastbeitrag (VON EINEM DER AUSZOG, EIN BUCH ZU VERÖFFENTLICHEN) zu kommentieren – und nun haben wir alle den Salat. Jetzt müssen Sie da durch. »Bisher habe ich für meine Kunst gelitten, jetzt sind Sie dran!« (Stephen Fry, »Das Nilpferd«)
In dem anderen Text ging es um die Schwierigkeit, die es bedeutet, eine Buchveröffentlichung zu stemmen. Verstärkt dadurch, dass der Autor es im Selbstverlag versucht. Es ist harte Arbeit, es kostet Geld. Auch dann, wenn es »nur« ein eBook ist und rechnet sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht einmal. Dass der Text als eine Art offener Brief an »die Raubkopierer« formuliert wurde, finde ich ein bisschen an der eigentlichen Problemlage vorbeigeschossen. Aber wie der Autor jenes Textes nun mit vollem Recht achselzuckend einwerfen könnte: »Pff! Jeder ist heute ein Kritiker…«
Mich interessiert hier eigentlich ein anderer Punkt, der nicht nur in jenem Text und vor allem in der ihm folgenden Diskussion anklang. Sondern eigentlich in fast allen mir bekannten Debatten zum Themenkomplex »Urheberrecht und Rechteverwertung in den Zeiten des Internets«. Die nach geradezu unheilige Behauptung, dass die Kunstentstehung selbst mit irgendeinem Geldfluss verquickt sein müsse. Für Filmproduktionen mag dieser Zusammenhang ja noch stimmen oder für jede Kunstform, in der viel Material und viele Menschen zur Entstehung notwendig sind. Aber gerade zumindest für die ersten Erschaffungsschritte von Literatur ist das schlicht nicht wahr.
Wenn also Ihnen, liebe nicht-schreibende Leserschaft mal ein Autor oder eine Autorin folgenden Satz sagt: »Wenn das so weitergeht mit der miesen Bezahlung, gibt es bald überhaupt keine neuen und originellen Bücher mehr, weil wir einfach das Schreiben an den Nagel hängen müssen«, glauben Sie es nicht! Da will Sie jemand in den Wald locken, Pfifferlinge sammeln! (Wie im übrigen auch, wenn Ihnen jemand – meist selbst KEIN Schreibender – sagt: »Wenn ein Buch nicht erfolgreich ist, ist es einfach nicht gut.« In so einem Fall rate ich zur Gesprächsaufgabe. Gegen die meisten Formen von echter Dummheit ist einfach kein Kraut gewachsen.)
Harte Arbeit
Verstehen Sie mich recht: Schriftstellerei ist eine wirklich WIRKLICH harte Arbeit. Natürlich ist es fair und nur angemessen, wenn Schreibende, wenn sie schon nicht hauptberuflich davon leben können (was toll wäre), wenigstens nicht immerzu draufzahlen müssen, während tausende und abertausende Leute Stunden und Tage besonderer Stimmung aus den Texten ziehen. Doch für die Frage, ob neue Literatur entsteht, ist die Bezahlung nur von zweitrangiger Bedeutung. Nicht umsonst ist kein Markt so übervoll von Erschaffenden, wie der Buchmarkt, von denen so gut wie keiner es sich eigentlich leisten kann, Bücher zu schreiben.
Die meisten Schreibenden (unter ihnen der Unterzeichnende) möchten am liebsten nichts anderes tun, als die Werke verfassen, die sie selbst gern lesen würden. Das ist auch gut so, und ich bin überzeugt davon, dass der Literaturmarkt sehr viel bunter wäre, wäre das die Realität, aber das ist sie nicht und war es wohl auch zu keiner Zeit. Oh ja, es gab und gibt sie natürlich immer wieder, die wenigen, bei denen es doch funktioniert, die vom Schreiben der Bücher leben können, auf die sie Lust haben, aber sie sind nur wie die Möhre, hinter der der Esel (alle anderen Schreibenden) erst gierend und irgendwann immer gleichgültiger hertrottet.
Nun kann man natürlich sagen: Was soll die penible Unterscheidung? Unterm Strich läuft es doch auf dasselbe hinaus – Autorinnen und Autoren sollen für ihre Arbeit angemessen Geld sehen, was dafür auch immer an erneuerten Gesetzen / Geschäftsmodellen etc. vonnöten ist.
Nach der relativ unmaßgeblichen Meinung des Unterzeichnenden gibt es da, und sei es nur im Denken der Literaturschaffenden, jedoch einen profunden Unterschied, der sich wie kaum ein zweiter auf die literarische Vielfalt und im weiteren Sinne die Qualität des »Angebotes« auswirkt.
Von der richtigen Herangehensweise eines Autors, bzw. der falschen…
Als ich anfing, an meinem ersten Roman zu arbeiten, war das für mich eine Befreiung. Vorher hatte ich nur Drehbücher geschrieben. Die würden im besten Fall (dem Fall einer Realisierung als Film) immer noch von weniger Menschen gelesen werden, als bequem in die abgerissene Halle des Hauptbahnhofes der Stadt Brandenburg passen. Und jede zweite Idee würde womöglich als zu teuer abgelehnt. Doch in einem Prosatext kann ich den Planeten von zehn Milliarden »Hosianna« singenden Heuschrecken kahl fressen lassen, während verdächtig sprachbegabte Robbenbabies auf dem Weg zu ihren neuen Brieffreunden am Südpol… ok, ich vergesse mich. Aber Sie verstehen den Punkt, auf den ich hinaus will: Sie, liebe Leserschaft mögen so etwas zu Recht nicht mögen, in Geldwert messbar teuer »herzustellen« war es für mich nicht. Ich kann den ganzen Laden hier in die Luft sprengen und es kostet mich nichts als ein paar Sekunden an der Tastatur.
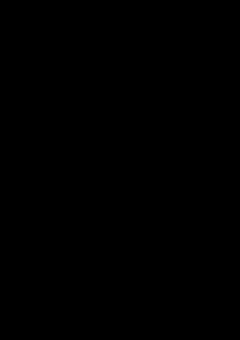 Ich hatte schon zu Beginn meiner Prosatätigkeit einige erfahrene Freunde im »Literaturgeschäft«, und sie alle rieten mir das Gleiche: »Zuerst schreibst Du ein Exposé für Dein Buch. Dann suchst Du Dir am besten einen Agenten. Der sucht Dir einen Verlag und wenn der Dir Schreibegeld gezahlt hat, DANN geht es los. NICHT VORHER! Sonst tust Du es womöglich für nichts.« Als ich trotzdem anfing, weil ich den Impuls loszuschreiben einfach nicht unterdrücken konnte, sah man mich milde lächelnd an. Man sprach von einem typischen Anfängerfehler. Nun, auch mit etwas mehr Erfahrung sehe ich das nicht so. Heute bin ich, noch ganz am Anfang und ohne Ahnung, ob es mich ernähren kann, Autor UND Verleger, und ich werde mal versuchen, meine Ansicht aus jeweils beiden Positionen zu erklären:
Ich hatte schon zu Beginn meiner Prosatätigkeit einige erfahrene Freunde im »Literaturgeschäft«, und sie alle rieten mir das Gleiche: »Zuerst schreibst Du ein Exposé für Dein Buch. Dann suchst Du Dir am besten einen Agenten. Der sucht Dir einen Verlag und wenn der Dir Schreibegeld gezahlt hat, DANN geht es los. NICHT VORHER! Sonst tust Du es womöglich für nichts.« Als ich trotzdem anfing, weil ich den Impuls loszuschreiben einfach nicht unterdrücken konnte, sah man mich milde lächelnd an. Man sprach von einem typischen Anfängerfehler. Nun, auch mit etwas mehr Erfahrung sehe ich das nicht so. Heute bin ich, noch ganz am Anfang und ohne Ahnung, ob es mich ernähren kann, Autor UND Verleger, und ich werde mal versuchen, meine Ansicht aus jeweils beiden Positionen zu erklären:
Warum erst schreiben und dann nach Finanziers suchen?
Als Autor sage ich Folgendes. Wenn ich eines Tages nicht mehr schreibe, bevor mich jemand dafür bezahlt, wird es Zeit, den Beruf an den Nagel zu hängen. Nur solange ich ohne äußerlichen Anreiz die Lust habe, Welten, Figuren und Geschichten um beides herum zu erfinden, kann ich genügend Elan und Willen in das Werk einbringen, um es so gut werden zu lassen, wie es mir möglich ist. Ich habe drei Kinder, ich muss regelmäßig zum Amt. Und nein, es ist nicht gut möglich, sich darin einzurichten. Doch mein Wunsch, aus der finanziellen Misere zu kommen, darf und wird keinen Einfluss darauf nehmen, was ich schreibe und wann ich es tue. Versprochen, echt jetzt! (Natürlich gibt es auch den Fall, dass AutorInnen mehr als eine Geschichte gleichzeitig in der Pipeline haben und einfach Prioritäten setzen. „Welche zuerst Interesse weckt, wird zuerst geschrieben.“ Um diesen Fall geht es hier ausdrücklich nicht!)
Schreibegeld als Verleger?
Als Verleger sage ich dies: Bleib mir weg mit Werken, die Du nicht auch dann schreiben MUSST, wenn Dich keiner dafür bezahlt! Ich habe nicht deshalb einen Verlag mitgegründet, der sich ausschließlich im Besitz von AutorInnen befindet, um Dir hinterher sagen zu müssen, was und wann Du schreibst. Versteh mich richtig: Das ist keine Entschuldigung für mich, Dir keinen Vorschuss zu zahlen. Wenn wir es nicht verbocken, wird der Verlag hoffentlich bald groß genug sein, das zu tun. Doch dieses Geld soll dann nicht Dein Schreibanreiz sein, sondern mein Versuch, Dir so lange den Rücken freizuhalten, bis Du termingerecht abgegeben hast.
Ich habe drei Kinder. Ich muss immer noch zum Amt. Also werde ich alles tun, Deinen Text möglichst oft zu verkaufen. Und ihn trotz der auch beim qualitativ hochstehenden eBook entstehenden Kosten wie Lektorat, Gestaltung, Marketing, etc. in die Gewinnzone zu fahren. Es mag ja Schreibende geben, deren Werken man die auf ein Geschäftsvernunftsmaß reduzierte Schreiblust nicht anmerkt, aber es sind soooo wenige.
Die Krux als Verleger
Sind wir jetzt vom Thema abgekommen? Eigentlich nicht. Denn genauso, wie die Lust am Schreiben eine bleiben sollte, die ohne äußerliche Anreize auskommt, sollte auch die Lust am gelesen werden für die Künstlerinnen und Künstler nicht zwangsläufig mit der Frage gekoppelt sein, ob auch alle bezahlt haben! Und in diesem Rahmen mutet es für mich falsch an, so viele Schreibende zu erleben, die sich einerseits nur allzu schnell unmögliche Verträge aufzwingen lassen. Damit sind nicht nur die Prozente gemeint, sondern zum Beispiel auch unverschämte Rechtevergaben, etc.. Aber andererseits ihre Leserschaft zumindest ansatzweise immer mehr als Zusammenrottung diebischen Gesindels betrachten. Der »man« erst Wohlwollen entgegenzubringen hat, wenn sie dafür bezahlt. (Wenn jemand darin einen Anklang an zum Beispiel das Beschimpfen von Hartz-IV-Betroffenen durch drastisch unterbezahlte und von der wahren Herkunft ihrer Fastarmut abgelenkter Lohnarbeiter hört, ist das nicht komplett zufällig.)
Der Hindernislauf bis zur illegalen Kopie
Nachdem ich den oben verlinkten Text gelesen hatte, habe ich mir den hocheitlen Spaß gemacht, meinen Roman von einem illegalen Portal herunterzuladen. Also: Zunächst musste ich bei Google durch ein paar Suchbegriffe ein Forum finden, in dem Links zu solchen Portalen aufgelistet sind. Dann musste ich eins auswählen. Dann kamen erst einmal zwei Werbe-Pop-Up-Fenster. Und dahinter eine Seite voll wackelnder Brüste und einem Wust an winzigen Buchcovern. Dazu kamen kaum formatierte Textbrocken und irgendwo eine kleine Suchmaske.

Kein Problem, einfach meinen Namen eingegeben und siehe da, mein Buch war »anwesend«. Das entdeckte ich allerdings erst wieder hinter zwei Werbefenstern: Titten und Börsenspekulationstricks für Anfänger. Dann konnte ich das eBook anwählen und bekam die »Seite des Buches«. Die Inhaltsangabe, den Verlagsnamen, VIELE wackelnde Brüste und irgendwo ganz unten ein Link. Der zu einer Internetseite führte (zwei Werbefenster), die den Link auf dem eigentlichen Downloadportal aktiv hielt, zu dem ich dann musste. Ich musste dort anzugeben, ich sei kein Premiumkunde, was einen Wartecountdown und VIEL Werbung erzeugte. Danach erst konnte ich eine ZIP-Datei herunterladen. Die hat dann mein Mac in irgendeinen Ordner mit kryptischem Namen entpackt hat. Diesen konnte ich ewig lang nicht finden. Und als ich ihn doch gefunden hatte, war da mein Buch in jedem eBook-Format drin, dass »calibre« exportiert. Und zwar in entsprechend minderer optischer Qualität!
Das soll leicht sein?
Und doch hatten laut Angabe des eBook-Portales bereits 2.500 Leute vor mir mein Buch heruntergeladen. Nun, ich bin bestimmt kein Freund des Portalbetreibers, bei dem bei jedem Werbe-Pop-Up wahrscheinlich ein bisschen die Kasse klingelt. Und wenn man es hochrechnet, kommt da mit Sicherheit einiges rum. Von dem ja wohl auch was in meine Kasse gehört hätte, aber den 2.500 bin ich nicht böse. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, sie hätten es gekauft, klar. Aber andererseits denke ich mir, dass bei jemandem, der sich durch diesen Dschungel geklickt hat, um an das Werk zu kommen, die Chance, dass er oder sie es wirklich mal vor die Augen nimmt, weitaus größer ist. Als zum Beispiel bei den ca. 11.000 One-Click-Button-Texthortern, die das Buch bei Amazon heruntergeladen haben, als es dort für zwei Wochen zur Einführung kostenlos zu haben war.
Das Sieben-Tage-eBook-Rückgaberecht am Pranger
Und wenn man sich schon über Raubkopierer aufregt, hat es das Sieben-Tage-eBook-Rückgaberecht bei Amazon mindestens genauso verdient, am Pranger zu stehen. Für Tausend-Seiten-Werke mag das unproblematisch sein. Aber für eine locker geschriebene Kriminal- und Geistergeschichte in handelsüblicher Taschenbuchlänge wie meine kann es den Tod bedeuten, dass bezahlte Werk ohne Angabe von Gründen bei voller Kostenerstattung zurückgeben zu können, in einem Zeitraum, der drei Mal ausreicht, um es zu lesen. Amazon: Bei uns lesen Sie es auch umsonst! Aber Sie kommen schneller ran und es ist legal!
Links zum Thema Schreibegeld
Weitere Artikel zum Thema:
Thomas Elbel: Von Einem der auszog, ganz allein ein Buch zu veröffentlichen.
Moritz Sauer: »Wer Bücher schreibt, geht ein Risiko ein.«
Matthias Wenzel: Internetpiraterie: Demokratischer Kapitalismus
Michael Hambsch: Crowdfunding funktioniert – aber nicht für Belletristik
Tarnkappe.info